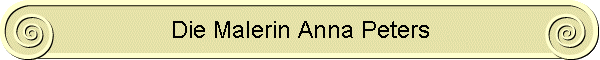|
Anna
Peters (*1843, †1926) ist eine der
ersten Frauen in Deutschland, die den Beruf einer Kunstmalerin
ausübten und von dem Verkauf ihrer Bilder leben konnten. Auf dem
Gebiet der Blumenmalerei
gelten ihre Gemälde als einzigartig in der Welt. Bereits in
ihrer frühen Schaffensphase schuf sie im Stil niederländischer
Stillleben des 17. und frühen 18. Jahrhunderts
Blüten- und Früchtekompositionen,
die heute noch auf Auktionen hoch dotiert werden. Daneben malte
sie auch Landschaftsbilder. Ende der 90er Jahre des 19.
Jahrhunderts entwickelte Anna Peters aus der streng
realistischen Bildsprache ihrer ersten Künstlerjahre einen
eigenen, geradezu impressionistischen Malstil. Nach 'Artprice',
dem Weltmarktführer für den Kunstmarkt, wechselten
zwischen 1989 und 2006 rund 230 ihrer Werke den Besitzer. Viele
Gemälde befinden sich in Privatbesitz. Über einige Jahre hinweg
bezog die Malerin jeweils im Sommer ihr Atelier im
Köngener Schloss.
Um das Werk von Anna Peters in die gesamte
Malerei einordnen und schätzen zu können, sollte man sich in
Erinnerung rufen, dass bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sowohl
Blumen- als auch Landschaftsbilder nicht als große Kunst
anerkannt und daher auch gering bewertet wurde. Im Vordergrund
standen religiöse und geschichtliche Darstellungen. Erst
im 19. Jahrhundert wurden in der Malerei
Landschaft und Stillleben als Thema interessant.
Künstlerinnen taten sich schwer, für andere als diese
Themen Anerkennen zu finden. Die anderen Themen waren
Männern vorbehalten.
| |
 |
Anna Peters: 'Bunter
Blumenstrauß', l auf Karton
Auktionshaus Zeller,
Lindau, 24.-25. Juni 2005
|
Anna Peters wurde am 28.
Februar 1843 als Tochter des niederländischen Landschaftsmalers
Pieter Francis Peters (* 1818, † 1903) und
seiner Frau Heinrika Mali in Mannheim geboren.
Ihre Mutter war eine Schwester des später als Tiermaler bekannt
geworden Christian Mali (*1832, † 1906). Bis zu
ihrem Umzug nach Stuttgart im Jahre 1845 lebte das Ehepaar in
Mannheim. Anna Peters wird - wie auch ihre Schwester Pietronella
- schon als Kind an ihren späteren Beruf herangeführt. In
Stuttgart besuchte sie ein privates Töchterinstitut und wohl
später auch das Katharinenstift. Die künstlerische Ausbildung
erfolgte den Vater Pieter Francis Peters und den Onkel Christian
Mali. Eine Ausbildung auf der Kunstakademie war in Stuttgart zu dieser Zeit
für Frauen nicht möglich.
|
|
Pieter Francis Peters
(* 1818,
† 1903), der sich in den 1840er Jahren dauerhaft
in Stuttgart niederließ, gehörte zu den ‚Hofaquarellisten‘
der späteren Königin Olga von Württemberg
(* 1822,
† 1892). Für seine Arbeiten fand sich neben den
fürstlichen Kreisen vor allem in der württembergischen
Hauptstadt eine zahlungskräftige Kundschaft, zumal er
auch rege am Stuttgarter Vereins- und Gesellschaftsleben
teilnahm. In einem Nachruf auf den 1903 verstorbenen
Peters wurde er als ein ‚weiten Kreisen
bekannter Künstler‘ bezeichnet, der
‚fleißig gemalt und fleißig ausgestellt hat‘.
Sein
„Hohenzollern-Album“, das insgesamt 35
Aquarelle mit „Ansichten der bemerkenswerthesten Puncte“
der „Hohenzollerischen Lande“ enthält und dem
preußischen Thronfolgerpaar 1858 von den
Bewohnern
dieser Region als Hochzeitsgeschenk überreicht wurde,
befindet sich heute im Besitz der Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in
Potsdam. Die außergewöhnlich atmosphärisch
wiedergegebenen Orte und Landschaften sollten dem
künfigen Kaiser Friedrich III. (* 1837,
† 1888) und seiner englischen Gemahlin die
vielfältige Schönheit der hohenzollerischen Stammlande
vor Augen führen.
|

|
Pietronella Peters: Bildnis ihres
Vaters Pieter Francis Peters im
Atelier, Öl auf Leinwand, 1893
Museum Biberach
|
|
|
Bereits im Jahr 1868, also im Alter von 25 Jahren, ergreift Anna
Peters
den Beruf einer selbständigen Malerin. Die Blumenmalerei blieb ihr Programm bis
ins hohe Alter. Die Blumen wurden zumeist aus der Aufsicht
gemalt. Häufig kombinierte sie Sträuße mit Gräsern und Zweigen.
Gelegentlich lockerte sie ihre Blumenensembles durch Insekten
auf. Das erste
bekannte Blumenbild von
Anna Peters zeigt einen 'Herbststrauß'
und ist mit dem Jahr 1860 datiert. Anna Peters unternahm auch
eine Reihe von Reisen und Malaufenthalten, meistens begleitet
von ihrem Vater oder ihrem Onkel, dem Maler Christian Mali. Die
frühesten von ihr gemalten Landschaften sind
eine Reihe von Aquarellen aus Interlaken in der Schweiz. Sowohl
Blumen- als auch Landschaftsbilder waren zunächst realistische
Abbildungen des Gesehenen. Das Anliegen von Anna Peters war es,
die einfachen, meist unbeachteten Dinge vor Augen zu führen. Es
sind Feld- und Gartenblumen, die sie zu Beginn ihres Schaffens als
Blumenmalerin malt. Die Blumen werden in allen nur möglichen
Stadium gezeigt: von der Knospe bis zum vollen Erblühen, vom
jungen Trieb bis zu verfärbten Herbstblättern. Dabei
bevorzugt sie ein künstliches Arrangement der Blumen. Eine
Symbolik oder ein moralischer Appell lässt sich in den Bildern
nicht erkennen.
| |
Für Anna Peters war die Natur
die einzige Lehrmeisterin ihrer Kunst. Ihre eigenen
Worte sind: "Je mehr sich der Künstler an die Natur
hält, je vollkommener wird sein Werk, denn die Natur ist
die höchste Weisheit selbst" |
Die zeichnerisch exakten Abbildungen
der Wirklichkeit gibt es bis 1886. In
diesem Jahr ändert sich der Malstil von Anna Peters. Bei den
Blumen- und Landschaftsbildern spielt nun das Atmosphärische
eine größere Rolle, der Pinselstrich wird entschieden lockerer.
Der natürlich gewachsene Untergrund oder der von Wolken
strukturierte Hintergrund wird bei ihren Blumenarrangements
immer häufiger. Die
Landschaftsbilder sind nun häufig schnell gemalte, oft im Freien
entstandene Impressionen. Auch hier spielt ab 1886 zunehmend der
bewegte Wolkenhimmel eine Rolle. Die meisten Vorlagen für ihre
Bilder entstammen der jeweiligen allernächsten Umgebung der
Malerin, so zum Beispiel aus ihrem Garten in
Stuttgart-Sonnenberg oder im ihrem dortigen Haus naheliegenden
Wald. In ihren Skizzenbüchern finden sich
Eintragungen aus der nahen und weiteren Umgebung ihres Wohnorts. Dazu gehört auch das Köngener Schlóss. Auch
längere Reisen zu weiter entfernten Orten fanden ihren
Niederschlag. Dazu gehörten Florenz, Rom, Nijmwegen und Lugano.
Der
Kontakt zwischen den Familien Peters und Mali war sehr eng.
Beginnend mit der
Pariser Weltausstellung
im Jahre 1867 verzeichnete die Malerei der
'Münchener Schule',
zu der neben Christian Mali
auch dessen Malerfreund
Anton Braith
(1836 - 1905) gehörte, einen großen Aufschwung, von dem auch
Anna Peters in ihrem künstlerischen Schaffen profitiert hat.
Über Jahrzehnte hinweg sind zahlreiche Besuche der Familie
Peters bei Christian Mali und Anton Braith in deren Atelierhaus
in München, der so genannten Schwabenburg, bekannt. Auch
Gegenbesuche in Stuttgart sind durch datierte Skizzen Christian
Malis belegt. Anna Peters begleitete Mali und Braith auf deren
Studientouren nach Südtirol. So findet sich ihr Name im
'Goldenen Buch' eines in Künstlerkreisen bekannten Weinlokals in
Bozen, neben dem ihres Onkels und dessen Malerfreund.
Ab 1869
nahm Anna Peters regelmäßig an Ausstellungen auch außerhalb
Stuttgarts teil. Berlin, Dresden und Wien gehörten zu ihren
Stationen. Im Jahr 1880 trat sie dem
'Verein Berliner Künstlerinnen'
bei, dessen Ausstellungen in der
Königlichen Kunstakademie sie regelmäßig mit ihren Bildern
beschickte. Für die Zeit von 1890 bis 1913 berichten ihre
Skizzenbücher neben Ausflügen in die nähere Umgebung Stuttgarts
auch von Reisen nach Rom, Florenz, Nymwegen (der Geburtsstadt
ihres Vaters) und Lugano.
Anna
Peters war gemeinsam mit Sally Wiest und
Magdalena Schweizer 1893 Gründerin des
'Württembergischen Malerinnenvereins'. Für den Ankauf
einer Villa gewährte sie dem Verein einen großzügigen Kredit.
Dieses Gebäude an der Eugenstraße in Stuttgart ist noch heute im
Besitz des 'Bundes Bildender Künstlerinnen' (BBK).
Anna Peters war, abgesehen von den Jahren 1902 bis 1904, bis
1919 Vorsitzende des Vereins. Neben der Ausrichtung
gesellschaftlicher Aktivitäten und der Organisation von
Ausstellungen, nahm der Verein durch die Einrichtung einer
eigenen Darlehens- und Unterstützungskasse
berufsgenossenschaftliche Aufgaben wahr. Wie ihre beiden
Schwestern blieb Anna Peters unverheiratet und engagierte sich
leidenschaftlich für bessere Arbeitsbedingungen für
Künstlerinnen. Sie fehlte bei keiner Veranstaltung, keinem
Vortrag, keiner Ausstellung des Vereins - vor allem auch bei
keinem Fest. Die legendären Bälle, welche die Malerinnen der
Stadt Stuttgart veranstalteten, wurden von den Peters-Schwestern
ausgestattet. Dass die württembergischen Künstlerinnen so
erfolgreich tätig waren verdanken sie auch der Königin
Charlotte, die den Verein unterstützte.
| |
 |
Anna Peters in ihrem
Atelier (wahrscheinlich in Stuttgart-Sonnenberg) an der
Staffelei
Bildquelle: Katalog
387 des Auktionshauses Nagel in Stuttgart vom 27./28.
März 2003
|
1912 zog
sich Anna Peters gemeinsam mit ihren Schwestern in das eigene
Haus in Stuttgart-Sonnenberg
zurück. Ihren Aufenthalten im
Köngener Schloss in den Sommern
von 1894 bis 1904, dann wieder 1907, 1913, 1915, 1919 und
letztmalig 1924 kam besondere Bedeutung zu. Dort entstanden
viele ihrer Bilder. Blumenarrangements, wurden, wie sie selbst
schreibt, "auf der Schlossmauer in Köngen platziert" und dann
von ihr gemalt. Landschaftsbilder zeigen Köngen und das Leben in
diesem Dorf. Beispiele sind die Gemälde 'Flusslandschaft mit
Brücke (Köngen)', 'Landschaft bei Köngen', 'Schloss Köngen bei
Mondlicht' und 'Dorfgasse mit Gänsen und Wagen'. Christian Mali
besuchte Anna Peters in den Jahren 1897 bis 1902 regelmäßig in
Köngen, 1901 und 1902 in Begleitung seines Malerfreundes Anton
Braith.
| |
Im Sommer 1894 hielten sich Anna und
Pietronella Peters zum ersten Mal im Köngener
Schloss auf. In diesem Jahr und auch in den
Folgejahren wurden sie von ihrem Onkel, dem bekannten
Tiermaler Christian Mali, im Schloss
besucht. In den Jahren 1901 und 1902 kam auch
Anton Braith, ein weiterer großer Maler, hinzu.
Der Vater Francis Peters teilte die
Aufenthalte in den Jahren 1896 und 1898 sowie 1902 kurz
vor seinem Tode. Die in Köngen entstandenen
Skizzenbücher von Anna Peters geben Zeugnis einer
besonders produktiven Schaffensphase in diesem Ort. Wie
aus Gemälden ersichtlich ist, verfügte Anna Peters im
Köngener Schloss über einen Salon und ein Atelier. Die
Mahlzeiten wurden im Gasthof zur Linde eingenommen.
|
| |

|
Das Köngener Schloss,
gemalt von Anna Peters um 1900
Privatbesitz
|
| |

|
Landschaft bei Köngen
("Die Linde"), gemalt von Anna Peters
Privatbesitz
|
| |

|
Dorfidyll in Köngen,
gemalt von Anna Peters um 1900
Privatbesitz
|
Anna Peters starb im Alter von
83 Jahren am 26.Juni 1926 in ihrem Haus in Stuttgart-Sonnenberg.
Sie wurde auf dem Stuttgarter Pragfriedhof im Familiengrab der
Peters beerdigt. Ihre
künstlerische Leistung ist unvergessen. Die Künstlerinnen waren
noch 1926 weit davon entfernt, gleichberechtigt mit ihren
männlichen Kollegen zu sein - auch wenn sie inzwischen an den
Akademien zugelassen waren.
|