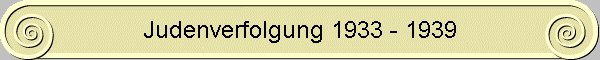|





Die Welt des späten
Mittelalters (1250 - 1400)
Das Ende der Luxemburger
und der Aufstieg der Habsburger Kaiserdynastie (1400 - 1517)
Die Reformation von
Luthers Anschlag der 95 Thesen bis zum Wormser Reichstag (1517 - 1521)
Der Dreißigjährige Krieg
(1618 - 1648)
Vom Westfälischen Frieden
(1648) bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen (1740)
Der Aufstieg Preußens zur
europäischen Großmacht (1740 - 1763)
Die Französische
Revolution bis zum Ende der Diktatur Robespierres (1789 - 1794)
Deutschland in der Zeit der
Französischen Revolution und der Herrschaft Napoleons (1789 - 1815)
Restauration und
Revolution (1815 - 1830)
Monarchie und Bürgertum (1830
- 1847)
Die Revolution von
1848/49
Von der gescheiterten
Revolution 1848 bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871
Die Innen- und Außenpolitik
Bismarcks (1871 - 1890)
Das Deutsche Kaiserreich
von 1890 bis zum Ausbruch der Ersten Weltkriegs 1914
Die Industrielle
Revolution in England und Deutschland (1780 - 1914)
Europäischer
Kolonialismus und Imperialismus (1520 - 1914)
Der Erste Weltkrieg (1914 -
1918)
Der Weg zur Weimarer
Republik 1918 - 1919
Der Kampf um die Staatsgewalt
in der Weimarer Republik (1919 - 1933)
Die Machtübernahme der NSDAP
und die Errichtung der Diktatur Hitlers (1933 - 1939)
Der Zweite Weltkrieg (1939
- 1945)
Der Weg in die Teilung
Deutschlands (1945 - 1949)
Der Kalte Krieg: Vom
Kriegsende 1945 bis zum Bau der Berliner Mauer 1961
Die Ära Adenauer (1949 -
1963)
Die Kanzlerschaft Ludwig
Erhards 1963 - 1966
Kalter Krieg Teil 2: Von
der Kubakrise 1962 bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991
Die Zeit der Großen
Koalition 1966 - 1969
Die Ära Brandt (1969 - 1974)
Die Kanzlerschaft Helmut
Schmidts (1974 - 1982)
Die Kanzlerschaft Helmut
Kohls von 1982 bis 1987
Die Kanzlerschaft Helmut
Kohls von 1987 - 1989
Der Weg zur
Wiedervereinigung Deutschlands (Teil I: Die DDR von den siebziger Jahren
bis zum Fall der Mauer im Jahr 1989)
Vom Fall der Berliner
Mauer bis zur deutschen Einheit (1989 - 1990)
|
|
|
| . |
|
zurück zur Seite "Deutschland
1933 - 1939" (Machtübernahme der NSDAP und die Errichtung der
Diktatur Hitlers)
|
|
|
weiter
zur Seite 'Vertreibung und Vernichtung der Juden 1939 - 1945'
|
|
| . |
- Juden im Deutschen Reich vor der
nationalsozialistischen Machtübernahme
| |
- Etwas mehr als eine halbe Million
Menschen bekannten sich im Deutschen Reich zum
Judentum (0,76% der Gesamtbevölkerung)
|
| |
- In einigen
Berufen waren
die Juden überproportional häufig vertreten: im
Handel, bei den Maklern und Bankiers, in den
Berufsgruppen der Ärzte und Rechtsanwälte, in
künstlerischen und kulturwissenschaftlichen Berufen.
|
| |
- Ein Großteil der deutschen Juden
fühlte sich nicht weniger als andere Deutsche in
Kultur und Heimatgefühl
eingebunden.
| |
Die jüdische
Minderheit war keinesfalls eine soziologisch und
politisch geschlossenen Gruppe mit gleichartigen
Überzeugungen und Verhaltensweisen. Auch lebten
sie in keiner doppelten Loyalität, nämlich
zuerst als Juden, dann als Deutsche. |
|
|
|
|
|
|
|
„Sie erklärt nämlich nicht hinreichend, warum immer die
Juden das Opfer solcher Krisen waren. Voraussetzung
dafür, dass die Nationalsozialisten sich mit der
Forderung nach einer antijüdischen Sondergesetzgebung im
Jahre 1933 durchsetzen sollten, war aber die
gesellschaftliche Ausbreitung des Antisemitismus in den
stabilen Jahren der Weimarer Republik innerhalb des
konservativen politischen Spektrums, aus dem die
Regierungspartner der NSDAP 1933 kamen.“
Einen fruchtbaren Nährboden fand der Antisemitismus
bereits lange vor 1933 im deutsch-nationalen Lager, in
Wehr- und Wirtschaftsverbänden, großen Teilen der
Studentenschaft, in der Justiz und der protestantischen
Kirche. Der Autor belegt an vielen Beispielen, dass es
sich eben nicht ausschließlich um ein Krisenphänomen
handelt, sondern um die negative Seite einer nationalen
Identitätssuche: „der Jude“ als das Zerrbild des
heimatverbundenen, patriotischen Deutschen.
Antisemitismus ist demnach auch keine Frage von
Randgruppen. Um 1900 war das Bildungsbürgertum
Trägerschicht der Judenfeindschaft.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Eine feindselige Stimmung gegen
die Juden hatte in vielen europäischen Ländern eine
lange Tradition. Ursache waren sowohl
religiöse
und wirtschaftliche Motive als auch eine
emotionale Fremdenfeindlichkeit. Mit zunehmender
Assimilation der Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts
gewann der Antisemitismus
an Gewicht. Das
Verhältnis zu den Juden wurde in wachsendem Maße als
Rassenfrage
verstanden. Die Juden wurden für
die Schattenseiten der Modernisierung und des
Kapitalismus verantwortlich gemacht. Es wurde ihnen
außerdem vorgeworfen, dass sie die europäischen
Völker kulturell überfremden würden.
|
|
-
Einen der
schärfsten Angriffe gegen die wirtschaftliche
Gesinnung der Juden formulierte 1844
Karl
Marx in seinem Aufsatz
"Zur Judenfrage".
Er sprach davon, dass die Juden weder
Religionsgemeinschaft noch Volk seien. Der
weltliche Grund des Judentums sei der Eigennutz,
ihr weltliches Gut das Geld, ihr wirklicher Gott
der Wechsel; der praktische Geist der Juden sei
jetzt praktischer Geist der christlichen Völker.
Das Judentum war für Marx "der höchste
praktische Ausdruck der menschlichen
Selbstentfremdung".
-
Voraussetzung dafür, dass
die Nationalsozialisten sich mit der
Forderung nach einer antijüdischen
Sondergesetzgebung im Jahre 1933
durchsetzen konnten, war die
gesellschaftliche Ausbreitung des
Antisemitismus in den Jahren der
Weimarer Republik innerhalb des
konservativen poltischen Zentrums. Einen
fruchtbaren Nährboden fand der
Antisemitismus im deutsch-nationalen Lager,
in Wehr- und Wirtschaftsverbänden, großen
Teilen der Studentenschaft, in der Justiz
und der protestantischen Kirche.
|
|
|
|
-
Für
Adolf Hitler
war der
Kampf zwischen "der jüdischen Rasse" und den
anderen Rassen ein beherrschendes Thema der
Geschichte. Aber auch unabhängig von den Juden
dachte Hitler in der Kategorie des
ewigen
Rassenkampfes. Die Völker hatten für ihn einen
unterschiedlichen Wert. In Reden und Schriften wies
er darauf hin, dass die Natur den Sieg des Stärkeren
und die Vernichtung und bedingungslose Unterwerfung
des Schwächeren wolle. Jedes Volk, jede Rasse,
strebe, so glaubte Hitler, nach Weltherrschaft.
Pflicht des Staates war es, so Hitler, verderbliche
Rasseneinwirkungen im Deutschen Reich zu verhindern.
|
|
Die
arische
Rasse hatte für Hitler den höchsten Rang.
Ihr stand die nordische Rasse am nächsten. Den
geringsten Wert hatten für ihn die Juden. Hitler
wurde nicht müde, den
zerstörerischen
Charakter der Juden zu beschreiben: Sie
waren schuld an der Auflösung der Einheit aller
Industrievölker. Die jüdische Presse liefere das
Denken dem Judentum aus. Den Höhepunkt des
"jüdischen Völkermords" sah Hitler im
Bolschewismus erreicht.
|
|
|
|
-
Schon im ersten Band von Hitler
Buch "Mein Kampf", das 1925 erschien, steht
eine Bemerkung über die Juden. "Es wäre Pflicht
einer besorgten Staatsführung gewesen", so schreibt
Hitler, "Verhetzer ... unbarmherzig auszurotten". Im
zweiten Band, 1927 erschienen, wird er noch
deutlicher. Die deutsche Niederlage im Ersten
Weltkrieg führte er darauf zurück, dass man sich
scheute, "zwölf- oder fünfzehntausend dieser
hebräischen Volksverderber so unter Giftgas zu
halten, wie es Hunderttausende an der Front erdulden
mussten .... Zwölftausend Schurken zur rechten Zeit
beseitigt, hätten vielleicht einer Million
ordentlicher, für die Zukunft wertvoller Deutschen
das Leben gerettet".
|
|
|
|
-
In Reden und Schriften der
Nationalsozialisten wurden die Juden häufig als
Ungeziefer, Krankheitskeime, Bazillen oder Viren
bezeichnet. Diese Ausdrücke suggerierten
insbesondere bei Kleinbürgern und verarmten
Angehörigen des Mittelstands die Notwendigkeit der
Vernichtung.
|
|
|
-
Dem
"Weltjudentum" wurden
Machenschaften gegen "die Deutschen"
unterstellt. Diese 'Verschwörungstheorie'
baute auf dem sozialen Neid der unteren
Bevölkerungsschichten gegen die besser situierten
Juden auf. Die Wirtschaftskrise des Jahres 1923,
während der viele Deutsche verarmten, wurde auf
Manipulationen der Juden zurückgeführt.
|
|
In einem
Aufruf zu einer Massenkundgebung
in München
Ende März 1933 hieß es, der Jude habe "es
gewagt, dem deutschen Volke den Krieg zu
erklären. Er betreibt in der ganzen Welt mit
Hilfe der in seinen Händen befindlichen Presse
einen groß angelegten Lügenfeldzug gegen das
wieder national gewordene Deutschland".
|
|
|
|
-
Die von der NSDAP veranlasste
Boykottaktion jüdischer Geschäfte am 1. April 1933
ließ die Juden zum ersten Mal tief erschrecken.
Viele Juden erkannten in dieser Maßnahme ein Signal,
dass die Nationalsozialisten nicht bei ihrem bisher
verbal zum Ausdruck gebrachten Antisemitismus stehen
bleiben würden.
| |
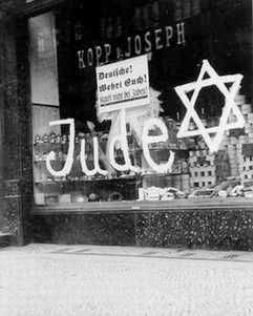 |
Boykottaktion
jüdischer Geschäfte im April 1933 in Berlin
Copyright:
Bildarchiv preußischer Kulturbesitz (bpk) |
|
|
Die
jüdischen
Offiziellen wiesen die "ungeheuerlichen
Anschuldigungen, die gegen uns deutsche Juden
erhoben werden" nahezu feierlich zurück. Sie
verwiesen auf die 12.000 jüdischen Gefallenen im
Ersten Weltkrieg.
|
|
|
|
|
-
Der 1. April 1933 wurde auf
Anweisung Hitlers zum Tag des
"Judenboykotts"
aufgerufen. Überall hingen Schilder mit der
Aufschrift: "Deutsche, kauft nicht beim Juden!". Vor
Läden, Kanzleien und Arztpraxen versuchten
SA-Männer, Kunden, Klienten und Patienten am
Betreten der Geschäfts- und Büroräume zu hindern. Es
war neu und zugleich bedrohlich, dass es der Staat
selbst war, der den Antisemitismus zur offiziellen
Politik erklärte.
|
|
Die Aktion war
kein Erfolg. Aus vielen Städten wurde berichtet,
dass die Bevölkerung die Aufforderung missachtet
habe. Vielfach wurde ganz demonstrativ bei Juden
gekauft, um die Missbilligung der Aktion
auszudrücken. Je länger die Nazi-Herrschaft
dauerte, desto schwieriger und seltener wurden
solche Demonstrationen der Solidarität
mit der unterdrückten jüdischen Minderheit und
der Bekundung von Opposition gegen das Regime.
Die Mehrheit der Deutschen ließ sich
einschüchtern, viele äußerten ihre Abneigung nur
noch heimlich, die meisten gewöhnten sich an den
Unrechtsstaat, seine Diskriminierungen und
Untaten.
|
|
|
|
|
|
Bedeutende
Wissenschaftler und Gelehrte gingen
gezwungenermaßen ins Ausland, darunter der
Physiker Albert Einstein, der Chemiker Fritz
Haber und der Psychoanalytiker Erich Fromm. Die
Philosophen Theodor W. Adorno und und Max
Horkheimer hatten Deutschland schon vor dem
April 1933 verlassen. Bedeutende Schriftsteller
kehrten bald darauf Deutschland den Rücken: die
Gebrüder Mann, Bertold Brecht, Alfred Döblin,
Franz Werfel, Walter Benjamin, Kurt Tucholsky
und viele andere.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die
entscheidende Frage, wer denn nun
eigentlich Jude war, wurde im September
1935 noch nicht beantwortet. Da Hitler
keine Entscheidung traf, einigten sich
das Reichsinnenministerium und die
Parteibürokratie auf einen Kompromiss:
Als 'Jude' sollten diejenigen
Nichtarier gelten, die zwei nicht
arische Großeltern besaßen.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Im
Oktober 1936
wurde es
jüdischen Lehrern verboten, Privatunterricht an
Nichtjuden zu erteilen. Damit verloren die
Betroffenen meist die letzte Einnahmequelle, die sie
nach dem Berufsverbot im Staatsdienst noch gehabt
hatten.
|
|
|
-
Ab
April 1937 war es den
Juden verwehrt, an den Universitäten den Doktortitel
zu erwerben. Im September 1937
verloren alle
jüdischen Ärzte die Krankenkassenzulassung, im
Juli 1938
die Zulassung zur Berufsausübung. Das
gleiche Schicksal traf Rechtsanwälte und andere
Berufsgruppen.
|
|
Die Anzahl der
'Entrechtungsmaßnahmen'
gegen die Juden war
fast endlos. Sie wurden von allen öffentlichen
Ämtern ausgeschlossen, aus Krankenhäusern,
Apotheken und Ausbildungsstätten vertrieben.
Dazu wurden sie menschlich geächtet. Durch die
Berufsverbote verlor die Mehrheit der deutschen
Juden ihre materielle Existenzgrundlage. Eine
freiwillige Auswanderung scheiterte meistens an
den hohen Kosten.
|
|
|
|
|
| |
 |
Ein Beispiel
für die soziale Ausgrenzung der Juden |
|
|
|
-
Im
Juli 1938 wurde eine
besondere Kennkarte für Juden eingeführt. Ab Anfang
Oktober 1938 wurde ein rotes 'J' in die Reisepässe
der Juden gestempelt.
-
Ab August 1938
mussten deutsche Juden stigmatisierende Vorname
annehmen: Männer mussten "Israel" als zweiten Namen
führen, Frauen "Sara". Die "Zweite Verordnung zur
Durchführung des Gesetzes über die Änderung von
Familiennamen und Vornamen" als auch die
"Richtlinien über die Führung von Vornamen" waren
wesentliche Schritte zur Ausgrenzung der deutschen
Juden, die zusammen mit der parallelen Entrechtung
Voraussetzung für die spätere Deportation und den
Massenmord waren.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bei diesen
Maßnahmen sollte es nicht bleiben! Am 14.
Oktober 1938 erklärte Göring, "die Judenfrage
müsste jetzt mit allen Mitteln angefasst werden,
denn sie müssten aus der Wirtschaft raus".
|
|
|
|
|
-
Aufgrund der Olympischen Spiele
1936 in Deutschland und der Besetzung des Rheinlands
hatte sich Hitler selbst lange antijüdischer
Ausfälle enthalten. Am 7. November 1938
sollte ein marginaler Anlass eine verhängnisvolle
Entwicklung einleiten: Ein siebzehnjähriger Jude,
Herszel Grynszpan, verübte in einem Akt der
Rache auf die Nachricht vom grausamen Schicksal
seiner Eltern an der deutsch-polnischen Grenze ein
Attentat auf den Legationsrat der deutschen
Botschaft in Paris, Ernst vom Rath.
|
|
Die Eltern
Herszel Grynszpans gehörten zu den 17.000 Juden,
deren Staatgehörigkeit zwischen dem Deutschen
Reich und Polen umstritten war. Sie waren von
der Gestapo über die polnische Grenze deportiert
und nach Polen getrieben worden. Nachdem Polen
die Grenzen schloss, irrten die Unglücklichen im
Niemandsland zwischen Deutschland und Polen hin
und her. Die Leiden seiner Eltern waren das
alleinige Motiv für die Tat Herszel Grynszpans.
|
|
|
|
-
Das Attentat von Paris war den
Nationalsozialisten hoch willkommen, es wurde zur
'Verschwörung des Weltjudentums' empor
stilisiert und diente in der Folge der endgültigen
Ausgrenzung der Juden aus allen sozialen und
ökonomischen Zusammenhängen.
Propagandaminister
Goebbels benutzte das Attentat zunächst zu
einer antisemitischen Pressekampagne.
Der 'Völkische Beobachter' schrieb am
8.
November 1938 in seinem Leitartikel: "Es ist
klar, dass das deutsche Volk aus dieser neuen Tat
seine Folgen ziehen wird". Der Artikel gab den
radikalen Antisemiten Anlass und Gewissheit, bei
ihrem Übergang zu den primitiven Formen physischer
Gewalt und Verfolgung im Sinne der Partei und des
Führers zu handeln. Noch am Abend des 8. November
fanden erste Ausschreitungen statt, die sich am
Morgen des nächsten Tages fortsetzten. Sie gingen
ausschließlich von örtlichen Parteiorganisationen
aus. Genaue Anweisungen der obersten
Parteileitung lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor.
| |
 |
Antisemitische
Pressekampagne am 8.11.1938 |
|
|
|
-
In der
Nacht vom 9. auf den
10. November 1938
kam es zu einem groß
angelegten Pogrom gegen die jüdischen Mitbürger. In
der nationalsozialistischen Propaganda wurde der
Angriff auf jüdische Geschäfte, Privathäuser und
Synagogen zynisch verharmlosend als
"Reichskristallnacht" bezeichnet. Es wurden
keineswegs nur Fensterscheiben von über 7.500
jüdischen Geschäften und 29 Warenhäusern zerstört
(wie der Name "Reichskristallnacht" suggeriert).
Weit über 1000 Synagogen und jüdische Gebetshäuser
fielen dem Pogrom zum Opfer. Zahlreiche Gebäude
waren nach der Gewaltnacht abbruchreif. Jüdische
Friedhöfe wurden geschändet. Mindestens 91 Menschen
wurden ermordet.
|
|
-
Die Angriffe auf
jüdisches Eigentum hatten am Abend des 9.
November immer festere organisatorische Formen
angenommen. Es herrscht heute kein Zweifel mehr
daran, dass der Angriff auf jüdisches Eigentum
keinesfalls dem 'entfesselten Volkszorn'
entsprang, sondern von staatlichen Stellen auf
höchster Ebene inszeniert war.
-
Am 9. November hatten sich,
wie alljährlich, in München die
"Alten
Kämpfer" getroffen, um des missglückten
Putsches vom November 1923 zu gedenken und die
Erinnerung an die einstige Niederlage mit einer
Demonstration der Macht zu verbinden. Auch
Hitler und der Propagandaminister
Goebbels
waren anwesend. Goebbels stellt
nach einem Gespräch mit Hitler in einer Rede
klar, dass die Partei Aktionen gegen die Juden
zwar nicht organisieren, aber auch nicht
verhindern werde, wenn sie
spontan
erfolgten. Er redete von Vergeltung und Rache
und vermittelte so bei den anwesenden
Parteiführern den Eindruck, dass die Partei
nicht nach außen als Urheber der Angriffe in
Erscheinung treten darf, sie aber zu Aktionen
aufgerufen seien. Von München aus gingen die
Weisungen der Parteiführer per Telefon an
die Gaupropagandaämter und von diesen weiter zu
den Kreis- und Ortsgruppenleitungen bzw. zu den
SA-Stäben im ganzen Reich. Wenig später brannten
die ersten Synagogen, wurden jüdische Menschen
gedemütigt und ausgeplündert.
|
|
|
|
-
Die
angebliche Demonstration
des Volkswillens gab dem nationalsozialistischen
Regime Anlass das zu tun, was längst beabsichtigt
gewesen war. Die "Reichskristallnacht" sollte den
Auftakt zu den
systematischen Maßnahmen
der Judenverfolgung und -vernichtung in Deutschland
und in den im Verlauf des 2. Weltkrieges eroberten
Nachbarlndern bilden.
|
|
|
|
|
|
|
Für die Wiederherstellung
der zerstörten Geschäfte mussten die
Juden selbst aufkommen. Der durch den
Terror angerichtete Schaden war zwar von
den Versicherungsgesellschaften zu
tragen, doch wurden deren Erstattungen
zugunsten des Reiches beschlagnahmt.
|
|
|
|
-
Die Juden wurden nun
systematisch
aus dem Wirtschaftsleben
verdrängt. Das Ziel war, so
Heydrich,
"die Juden aus Deutschland
herauszubekommen". Die vollständige
'Arisierung' erst aller
Einzelhandelsgeschäfte, dann der Fabriken
und Beteiligungen waren am 12. November 1938
schon eine beschlossene und von Hitler
entschiedene Angelegenheit. In der der Folge
wurden jüdische Gewerbebetriebe enteignet;
sie wurden von staatlichen Treuhändern unter
Wert geschätzt und zum normalen Verkehrswert
an Arier weiterverkauft. Der Besitz von
Wertpapieren wurde den Juden untersagt.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Göring am 12. November 1938:
"Wenn das deutsche Volk in irgendeiner absehbaren
Zeit in außenpolitischen Konflikt kommt, so ist es
selbstverständlich, dass wir auch in Deutschland in
allererster Linie daran denken werden, eine große
Abrechnung mit den Juden zu vollziehen".
|
|
|
|
|
|
|
|
"Das schwarze
Korps", Organ der Reichsführung SS,
galt als Kampf und Werbeblatt.
Jeder SS-Angehörige war verpflichtet, diese
wöchentlich erscheinende Zeitung zu lesen und
für deren Verbreitung zu sorgen.
|
|
|
|
-
Am
30. Januar 1939 drohte
Hitler in einer Reichstagsrede, dass der Untergang
der Juden die Folge sein würde, wenn es dem
Weltjudentum noch einmal gelingen sollte, die Welt
in einen großen Krieg zu stürzen.
|
|
Die Drohung
Hitlers enthielt die klassische Stereotype des
Antisemitismus, nämlich die Unterstellung einer
internationalen Verschwörung des Judentums.
Daneben beschuldigte er die Juden, den Ersten
Weltkrieg angezettelt zu haben und sprach davon,
die Juden hätten Deutschland den Krieg erklärt.
|
|
|
-
Von dem
Großteil der Bevölkerung
wurden die antisemitischen Gesetze des NS-Regimes und das
brutale Vorgehen in der Nacht vom 9. auf den 10. November
1938 schweigend hingenommen. Eine gewisse Gleichgültigkeit
gegenüber den Vorgängen und den Methoden der
nationalsozialistischen Judenpolitik breitete sich aus. Auch
die Furcht, etwas "Unrechtes" zu sagen und dafür bestraft zu
werden, war ein Grund für die kritiklose Hinnahme des
Vorgehens gegen die Juden.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
Als die deutschen Truppen
im März 1939 die tschechischen
Kernländer Böhmen und Mähren
besetzten, versuchten tausende dort
wohnender Juden zu entkommen. Bis Ende 1939
hatten es 10.000 der insgesamt 32.000 Juden
geschafft, Europa zu verlassen.
|
|
|
|
-
Im
Juli 1938 fand in der
Nähe von Genf eine internationale Konferenz statt,
die den Problemen der jüdischen Auswanderung aus
Deutschland gewidmet war. Eingeladen hatte
US-Präsident Roosevelt, gekommen waren Vertreter
von 32 Staaten und vieler jüdischer Organisationen.
Es geschah jedoch wenig, was die
Emigrationsmöglichkeiten der Juden aus Hitlers
Machtbereich verbessert hätte. Der australische
Delegierte erklärte: "Da wir kein Rassenproblem
haben, legen wir keinen Wert darauf, eines zu
importieren."
|
|
|
-
Aufgrund der staatlich
verordneten Diskriminierungen verschlechterten sich
die Existenzbedingungen für die deutschen
Juden im Herbst 1938 drastisch. Die
Verdrängung aus der Wirtschaft förderte einerseits
den Willen zur Auswanderung, andererseits hemmten
die Beschlagnahme des Vermögens und hohe Abgaben die
Möglichkeit, in ein anderes Land auszuwandern. Von
Seiten des NS-Regimes verstärkte sich Anfang 1939
der Druck zur Emigration.
|
|
|
-
Adolf Eichmann, seit 1934
Judenreferent im Sicherheitsdienst (SD) Heinrich
Himmlers, organisierte im August 1938 die
'Zentralstelle für jüdische Auswanderung'
in
Wien. Im Januar 1939 wurde in Berlin die
'Reichszentrale für jüdische Auswanderung'
gegründet. Sie unterstand dem Chef der
Sicherheitspolizei, Reinhard Heydrich.
|
|
|
|
|
|
|
-
Die Erkenntnis, dass das nationalsozialistische
Regime die Grenzen staatlicher Befugnis
überschritt, sowie die Empörung über die
diskriminierende Behandlung von Minderheiten und
Randgruppen, zu denen neben den Juden auch Sinti
und Roma, Homosexuelle und Behinderte gehörten,
führten einzelne Menschen zur Auflehnung
gegen das NS-Regime. Die Formen reichten von der
Verweigerung von staatlichen Anordnungen bis zu
offenem Protest. Außerdem gab es heimliche Hilfe für
Juden.
|
|
|
-
Die Möglichkeit, Opposition zu leisten, wurde von
dem immer perfekter arbeitenden Überwachungssystem der Nationalsozialisten stark
eingeschränkt. Jeder Protest gegen das Nazi-Regime
war mit hohem Risiko für das eigene Leben verbunden.
Es gibt trotzdem viele Beispiele von Widerstand
einzelner Personen, die ihrem Gewissen folgten
und nicht bereit waren, alles hinzunehmen. Ein
solches Beispiel öffentlichen Widerstands ist die Bußtagspredigt, die der evangelische Pfarrer
Julius von Jan am 16. November 1938 – also
wenige Tage nach der Reichskristallnacht - im
württembergischen Oberlenningen hielt.
| |
 |
Julius von Jan (*1897,
†1964), evangelischer Pfarrer, als "Judenknecht"
verschrien, Widerstandskämpfer gegen Hitler
Kirchengemeinde Oberlenningen:
Zum Gedenken an Julius von Jan (Bildausschnitt). |
|
|
-
Die Predigt Julius von Jans war eine
eindrucksvolle und in ihrer Deutlichkeit
einmalige Demonstration gegen den
Antisemitismus und gegen den NS-Staat.
Der schwäbische Landpfarrer nahm kein Blatt
vor den Mund: Von "Lügenpredigern" sprach
er, die "nur Sieg und Heil rufen können".
Vom "organisierten Antichristentum" und
"Männern, die bloß weil sie einer anderen
Rasse angehören, ins KZ geworfen wurden.
Schließlich sprach er auch von Bischöfen,
die zu all dem geschwiegen hätten. Hier einige Auszüge aus der Predigt:
|
|
-
„Wenn nun die einen schweigen müssen
und die andern nicht reden wollen,
dann haben wir heute wahrlich allen
Grund, einen Bußtag zu halten, einen
Tag der Trauer über unsere und des
Volkes Sünden."
|
|
|
-
„Die Leidenschaften sind entfesselt,
die Gebote Gottes missachtet,
Gotteshäuser, die andern heilig
waren, sind ungestraft
niedergebrannt worden, das Eigentum
der Fremden geraubt oder zerstört,
Männer, die unsrem deutschen Volk
treu gedient haben und ihre Pflicht
gewissenhaft erfüllt haben, wurden
ins KZ geworfen, bloß weil sie einer
andern Rasse angehörten! Mag das
Unrecht auch von oben nicht
zugegeben werden – das gesunde
Volksempfinden fühlt es deutlich,
auch wenn man nicht darüber zu
sprechen wagt.“
|
|
|
-
„Ja, es ist eine entsetzliche Saat
des Hasses, die jetzt wieder
ausgesät worden ist. Welche
entsetzliche Ernte wird daraus
erwachsen, wenn Gott unsrem Volk und
uns nicht Gnade schenkt zu
aufrichtiger Buße."
|
|
|
-
„Äußeres Glück, äußere Erfolge
führen uns Menschen nur zu leicht in
einen Hochmut hinein, der den ganzen
göttlichen Segen verderbt und
deshalb in tiefem Fall endet.“
-
Die Predigt beendete er mit den
Worten: "Gott Lob! Es ist
ausgesprochen. Nun mag die Welt tun,
was sie will." (Er wusste genau, was
ihn erwartete)
|
|
|
-
Am Ende des Gottesdienstes verlas
Julius von Jan eine Liste von
Pfarrern, die mit Redeverbot oder
Landesverweisung bestraft worden
waren. Im Schlussgebet bat er, dass
Gott „dem Führer und aller Obrigkeit
den Geist der Buße schenken möge“.
|
|
|
|
-
Am
25. November 1938 wurde Julius von
Jan von 200 SA-Leuten in Zivil, die mit
Lastwagen aus Nürtingen und Kirchheim
gekommen waren, vor seinem Pfarrhaus
überfallen und schwer misshandelt. Man
traktierte ihn, so erzählt er später, mit
Fäusten, Stahlruten und Riemen. Anschließend
kam er in das Gefängnis in Kirchheim/Teck.
Da ihm die dortigen Richter und Wächter
sowie die christliche Bevölkerung der
Umgebung, wie er selbst in einem
Lebensrückblick im Jahr 1960 schreibt,
„allzu viel Sympathie bekundeten“, wurde er
im Februar 1939 in ein Stuttgarter Gefängnis
überführt. Im März geriet er aus dem
Gewahrsam der Justiz in Gestapo-Haft. Mitte
April wurde er aus Württemberg ausgewiesen.
| |
Als Julius von Jan
im Gefängnis in Kirchheim/Teck saß,
kamen Gemeindemitglieder aus
Oberlenningen und sangen Choräle unter
seinem Fenster. |
|
|
|
-
Am 15. November 1939 wurde von Jan
aufgrund des „Heimtückegesetzes“ von
einem Stuttgarter Sondergericht zu 16
Monaten Gefängnis verurteilt. Anfang Juni
1943 wurde der Geistliche zum Kriegsdienst
eingezogen. Mitte 1943 schickte man ihn als
Artillerist in einer Strafkompanie nach
Russland und die Ukraine. Dort erkrankte er
schwer. Auch als Soldat stand er, wie er
selbst berichtet, bis zum 8. Mai 1945 "unter
ständiger Kontrolle der NSDAP".
|
|
|
-
Im September 1945 kehrt Julius von
Jan, gesundheitlich schwer angeschlagen, mit
seiner Familie nach Oberlenningen zurück.
Der Sinn stand ihm nicht nach Rache, obwohl
die Rädelsführer von damals bekannt sind und
zum Teil schon wieder bürgerlichen Berufen
nachgehen. In
Stuttgart-Zuffenhausen übernahm er 1949
seine letzte Gemeinde. Ab Januar 1958 ist er
arbeitsunfähig. Seinen Ruhestand verbrachte
der Pietist von Jan im Kreise der
Brüdergemeinde in Korntal bei Stuttgart.
Dort stirbt er 1964 im Alter von
67 Jahren. Mitte 2019 soll der Grabstein
Julius von Jans nach Oberlenningen kommen
und auf dem Kirchhof rund um die
Martinskirche einen würdigen Platz erhalten.
-
Im Jahr 2018 erhielt Julius von Jan posthum
den Ehrentitel "Gerechter unter den
Völkern". Diese Auszeichnung, die
von der Gedenkstätte Yad Vashem
in Jerusalem verliehen wird, würdigt von
Jans Engagement gegen die Verfolgung der
Juden im Nationalsozialismus
|
|
|
|
|
|
|
|
zurück zur Seite "Deutschland
1933 - 1939" (Machtübernahme der NSDAP und die Errichtung der
Diktatur Hitlers)
|
|
|
weiter
zur Seite 'Vertreibung und Vernichtung der Juden 1939 - 1945'
|
|
|
Stand: 10.05.2021
Copyright © 2021 Geschichts- und Kulturverein Köngen e.V. Autor: Dieter
Griesshaber
|
|
Datenschutzhinweis
|
|
|