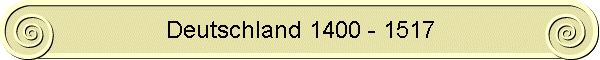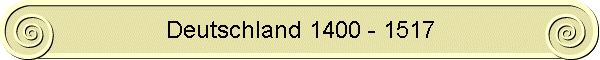|





Die Welt des späten
Mittelalters (1250 - 1400)
Das Ende der Luxemburger
und der Aufstieg der Habsburger Kaiserdynastie (1400 - 1517)
Die Reformation von
Luthers Anschlag der 95 Thesen bis zum Wormser Reichstag (1517 - 1521)
Der Dreißigjährige Krieg
(1618 - 1648)
Vom Westfälischen Frieden
(1648) bis zum Regierungsantritt Friedrichs des Großen (1740)
Der Aufstieg Preußens zur
europäischen Großmacht (1740 - 1763)
Die Französische
Revolution bis zum Ende der Diktatur Robespierres (1789 - 1794)
Deutschland in der Zeit der
Französischen Revolution und der Herrschaft Napoleons (1789 - 1815)
Restauration und
Revolution (1815 - 1830)
Monarchie und Bürgertum (1830
- 1847)
Die Revolution von
1848/49
Von der gescheiterten
Revolution 1848 bis zur Gründung des Deutschen Reiches 1871
Die Innen- und Außenpolitik
Bismarcks (1871 - 1890)
Das Deutsche Kaiserreich
von 1890 bis zum Ausbruch der Ersten Weltkriegs 1914
Die Industrielle
Revolution in England und Deutschland (1780 - 1914)
Europäischer
Kolonialismus und Imperialismus (1520 - 1914)
Der Erste Weltkrieg (1914 -
1918)
Der Weg zur Weimarer
Republik 1918 - 1919
Der Kampf um die Staatsgewalt
in der Weimarer Republik (1919 - 1933)
Die Machtübernahme der NSDAP
und die Errichtung der Diktatur Hitlers (1933 - 1939)
Der Zweite Weltkrieg (1939
- 1945)
Der Weg in die Teilung
Deutschlands (1945 - 1949)
Der Kalte Krieg: Vom
Kriegsende 1945 bis zum Bau der Berliner Mauer 1961
Die Ära Adenauer (1949 -
1963)
Die Kanzlerschaft Ludwig
Erhards 1963 - 1966
Kalter Krieg Teil 2: Von
der Kubakrise 1962 bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991
Die Zeit der Großen
Koalition 1966 - 1969
Die Ära Brandt (1969 - 1974)
Die Kanzlerschaft Helmut
Schmidts (1974 - 1982)
Die Kanzlerschaft Helmut
Kohls von 1982 bis 1987
Die Kanzlerschaft Helmut
Kohls von 1987 - 1989
Der Weg zur
Wiedervereinigung Deutschlands (Teil I: Die DDR von den siebziger Jahren
bis zum Fall der Mauer im Jahr 1989)
Vom Fall der Berliner
Mauer bis zur deutschen Einheit (1989 - 1990)
|
|
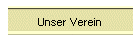  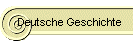 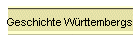 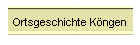 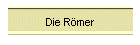 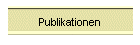 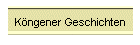 |
|
|
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis Deutsche Geschichte
weiter zur
nächsten Seite
zurück zur vorangehenden Seite
|
|
|
König Sigismund
König Friedrich III.
König Maximilian I.
Literaturhinweise
Schwaben 1400 - 1520
Köngen 1400 - 1520 (exemplarisch für ein Dorf)
|
|
|
Das Königtum im ausgehenden Mittelalter
|
|
-
Die Aufgabe des deutschen Königs, den
Frieden des Reiches nach innen und außen
zu sichern,
konnte mit der mittelalterlichen Lehenstruktur nicht mehr
erfüllt werden. Dem König fehlte es an
finanziellen
und militärischen Mitteln, um die widerstrebenden
Reichsstände zur Reichstreue und zur Wahrung des inneren
Friedens zu zwingen und die Stellung des Reichs innerhalb
der Staatenwelt Europas zu wahren.
|
-
Nur ein Herrscher mit einem starken
Rückhalt im eigenen Territorium (d.h. mit einer starken
Hausmacht) konnte hoffen, seine Forderungen
durchzusetzen (bzw. die Erwartung auf Friedenssicherung zu
erfüllen). Die Bereitschaft, das Hausgut für Reichsbelange
einzusetzen, wurde dadurch geschwächt, dass die Königswürde
nach dem eigenen Tod durch die Wahl der Kurfürsten auf ein
anderes Geschlecht übergehen konnte.
|
|
|
|
|
Das Königtum im ausgehenden Mittelalter
König Friedrich III.
König Maximilian I.
Literaturhinweise
|
|
|
Sigismund von Luxemburg (Deutscher
König 1410 - 1437, Römisch-deutscher Kaiser seit 1433)
|
|
- Die Situation des Reiches zu Beginn des 15.
Jahrhunderts
| |
|
|
Mit der "Goldenen
Bulle" hatte das Ringen um die
Modalitäten der Königswahl im Heiligen Römischen
Reich ein für alle Parteien rechtlich
bindendes Ende gefunden. Sie bestimmte die
Bischöfe von Köln, Mainz und Trier, den
Markgrafen von Brandenburg, den Herzog von
Sachsen, den Pfalzgrafen bei Rhein sowie den
König von Böhmen zu den sieben Kurfürsten und
bestätigt zugleich die dynastische Erbwahl.
Frankfurt am Main wurde als Wahlort
festgeschrieben. Die Bedeutung der "Goldenen
Bulle" war nachhaltig: Als erstes
reichsumfassendes Gesetz regelte sie
bis zum Ende des Alten Reiches 1806 verbindlich
die Formalitäten der Wahl zum König.
|
|
|
|
|
|
| |
-
Sigismund
ist der Jüngere der beiden Söhne
Karls IV. (geboren 1368).
-
Als der ältere Sohn Karls IV.,
Wenzel, 1378 die Herrschaft über das
römisch-deutsche Reich antrat, zeigte sich bald,
dass er die Erwartungen der Reichsfürsten nicht
erfüllen konnte. Er besaß weder das taktische
Geschick seines Vaters noch dessen
Durchsetzungskraft. In der Frage der abendländischen
Kirchenspaltung
(Schisma) traf er keine Entscheidungen,
und auch einen allgemeinen Landfrieden konnte
er erst nach jahrelangen schweren Konflikten mit
Fürsten und Städtebünden durchsetzen. Immer mehr zog
er sich von Reichsgeschäften zurück und
konzentrierte seine Kräfte auf seine
Hausmachtspolitik in Böhmen. Am 20. August 1400
wurde er von den rheinischen Kurfürsten in Lahnstein
als "unnützer, träger, unachtsamer Entgliederer und
als unwürdiger Inhaber des Reichs" abgesetzt. Er
blieb jedoch König in Böhmen.
-
Nach dem Tod des auf Wenzel
folgenden Ruprecht von der Pfalz (Rupprecht
III.) wählte am 20.September 1410 ein Teil der
Kurfürsten
Sigismund zum deutschen König. Die Gegenpartei
wählte Jobst von Mähren. Als dieser 1411
starb, herrschte Sigismund unangefochten.
|
| |
| |
Die Wahl von zwei
Königen war eine Folge der Kirchenspaltung: das
Kurfürstenkollegium war schon bei der Papstwahl
im Jahr 1378 in sich gespalten und verhielt sich
nun dementsprechend bei der Königswahl. Wenzel,
König von Böhmen, hatte seit 1400 keine Macht im
Reich.
|
|
| |
 |
Sigismund von Luxemburg
(*1368, † 1437), römisch-deutscher König von von
1411 bis 1437, römisch-deutscher Kaiser von 1433
bis 1437 |
|
|
|
| |
-
1433: Sigismund wird in Rom
zum Kaiser gekrönt.
|
|
- Die Regierungsziele Sigismunds
| |
-
Kircheneinigung und Kirchenreform
-
Reichsreform
-
Abwehr der osmanischen Expansion
-
Wahrung und Erweiterung der
Hausmacht
|
|
- Kircheneinigung und Kirchenreform
| |
- Das 'Abenländische
Schisma' (1378)
|
| |
| |
-
Unter dem Druck der
römischen Öffentlichkeit, die einen
Italiener als Papst forderte, erfolgte am 8.
April 1378 die Wahl des Erzbischofs von
Bari, Bartalomeo Prignano, zum neuen Papst.
Urban VI., wie sich der neue Papst
nannte, versuchte die Privilegien der
Kardinäle zu beschneiden. Ein Teil des
Kardinalskollegiums setzte ihn am 9. August
1378 wieder ab. Am 20. September 1378
wählten diese Kardinäle Robert von Genf,
einen Verwandten des französischen Königs,
zum neuen
Papst Clements VII..
Dadurch, dass
Urban VI.
sich weiterhin als rechtmäßigen Papst
betrachtete, wurde das
'Abendländische Schisma' ausgelöst,
das die Kirche in eine verfassungsmäßige und
tiefe religiöse Krise stürzte. Die
Bruchlinie zwischen den beiden Obödienzen
(Gehorsamsbereichen) zog sich quer durch
Europa. Während
Frankreich
und seine Anhänger den in Avignon
residierenden Papst Clemens VII.
anerkannten, folgten das Heilige
Römische Reich und seine
Verbündeten Papst Urban VI.
in Rom. Ordensgemeinschaften, Klöster,
Bistümer und Pfarreien mussten sich
entscheiden, welchem Papst sie folgen
wollten.
|
| |
| |
 |
Papst Urban VI. (*1318, †
1389)
Papst von 1378 bis 1389 |
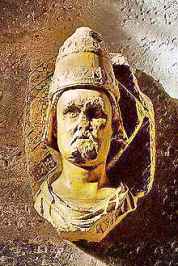 |
Papst Clemens VII.
(*1342, † 1394)
Papst von 1378 bis 1394
Bild: Musée
der Petit Palais in Avignon |
| |
|
|
|
|
|
| |
-
Papst Urban VI.
starb 1389,
Papst Clemens VII.
im Jahr 1394. Nach dem Tod dieser
Päpste wählten die Kardinäle
beider Seiten wieder einen eigenen Papst (Gregor
XII. in Rom und
Benedikt
XIII.
in Avignon).
-
Beim
Konzil von
Pisa im Jahr 1409 werden sowohl
Gregor XII. als auch
Benedikt XIII. abgesetzt.
Von beiden Päpsten wird der
Absetzungsbeschluss des Konzils nicht
anerkannt. Der in Pisa gewählte Papst
Alexander V. besteigt nun ebenfalls
den Heiligen Stuhl.
Als Alexander V.
im Jahr 1410 stirbt, wird
Johannes
XXIII. zum Papst gewählt. Mit
Gregor XII.,
Benedikt XIII. und
Johannes
XXIII. beanspruchen
drei Päpste den
Stuhl Petri für sich.
|
|
|
|
|
Kriege und die
drohende Spaltung der Christenheit waren
die Folgen des
"Abendländischen
Schismas". Es ging jetzt um
existentielle Fragen der Kirche:
Das Papsttum, im Zusammenspiel mit dem
römisch-deutschen Kaisertum eine der
tragenden Säulen der Christenheit, war
handlungsunfähig geworden. Darüber
hinaus drohte der Christenheit weiteres
Unheil: Missstände wie der
Verkauf von Kirchenämtern oder
der
Ablasshandel
sorgten unter den
Gläubigen für Unmut und ließen
Reformbewegungen sprießen, die zum
Schutz des Seelenheils eine Umkehr
forderten.
|
|
|
|
| |
-
Ziel:
Reorganisation des
Reiches; der Verfall der Königsmacht soll
beendet werden.
-
Den Plan einer Reichsreform sowie den
einer großen europäischen Koalition zum
Kreuzzug gegen die Türken konnte Sigismund nicht
verwirklichen.
-
Die Reorganisation des Reiches
scheiterte nicht zuletzt durch die drängenden
Aufgaben in Ungarn und in Böhmen. Auf Böhmen konnte
Sigismund nicht verzichten; seit Karl IV. war es
Kern der luxemburgischen Hausmacht. Der
Kampf um
das böhmische Erbe zwang Sigismund, sich häufig
in diesem Krisengebiet aufzuhalten. Die Folge war
die Vernachlässigung der Reichspolitik.
-
Durch seine zahlreichen Versuche
ordnenden Eingreifens ist es Sigismund jedoch unter
geschickter Ausnutzung der vorgegebenen
Konstellation gelungen, den unter seinen Vorgängern
eingetretenen Verfall der Königsmacht zu
stoppen und die imperiale Stellung des Reichs
wenigstens vorübergehend zu erneuern.
|
|
- Abwehr der osmanischen Expansion
| |
|
|
Sigismund, seit
1387 ungarischer König, wollte den
Expansionsdrang der Osmanen nach Europa
unterbinden. In der Niederlage der Serben bei
der Schlacht auf dem Amselfeld (1389) sah er ein
letztes Warnzeichen.
|
|
| |
-
1396:
Ein Heer, bestehend aus ungarischen, deutschen und
französischen Rittern wird bei
Nikopolis im
Norden Bulgariens von den Osmanen völlig aufgerieben.
Angesichts der schweren Niederlage sahen sich die
christlichen Reiche vorerst außerstande, dem
Vordringen der Osmanen auf dem Balkan Einhalt zu
gebieten.
|
|
Sigismund wurde
bei seinem Kreuzzug vom Papst in Rom nicht
unterstützt. Grund war die Kirchenspaltung von
1378: Burgund, das sich am Kreuzzug beteiligte,
stand auf der Seite der Avignonpäpste. Johann
ohne Furcht, der Sohn Herzog Philipps
des Kühnen von Burgund, führte das französischen
Truppenkontingent an. In Selbstüberschätzung
bestand er darauf, den ersten Schlag gegen die
Osmanen ohne das durch Sigismund befehligte
deutsch-ungarische Heer zu führen. Blindlings
liefen die Franzosen in die Falle, die Sultan
Bayezid ihnen gestellt hatte.
|
|
| |
- Sigismund bemühte sich bis zu
seinem Tod im Jahre 1437 vergeblich, seine
europäischen Länder zu einem
Herrschaftsverband
zusammenzuschließen, der den Kampf gegen die Osmanen
aufnehmen konnte.
|
|
- Wahrung und Erweiterung der eigenen Hausmacht
| |
-
Karl IV.
hatte gezielt nach Möglichkeiten gesucht, die Könige
von Polen und Ungarn, die beide keine Söhne hatten,
zu beerben. 1372 wurde eine Ehe zwischen
seinem Sohn Sigismund und einer Tochter Ludwigs I.
von Ungarn vereinbart (Ludwig I. regierte in
Personalunion auch Polen).
|
| |
-
Als Ludwig I. 1382 stirbt, scheitert
die Nachfolge Sigismunds in Polen am Widerstand des
dortigen Adels.
|
| |
-
1387:
Durch Heirat mit Maria von Ungarn, wird
Sigismund ungarischer König.
| |
Der ungarische
Adel verlangte für die Thronfolge Sigismunds
sehr viel Geld. Sigismund musste 1388 die
Kurmark an seinen Vetter Jobst von Mähren
verpfänden. 1402 verkaufte er die Neumark an
den Deutschen Orden. |
|
| |
|
| |
| |
 |
Johannes (Jan) Hus
(* um 1370, † 1415), theologischer Reformer |
|
| |
| |
-
Johannes
Hus
bekämpfte zunächst (um 1410) nur die
Verweltlichung der Kirche. Durch seine Förderung
der tschechischen Sprache wurde er immer mehr
zum Begründer einer
böhmisch-nationalkirchlichen Bewegung. 1411
wird er vom Papst exkommuniziert. Sein Kampf
gegen den Ablass führte auch zu politischen
Auseinandersetzungen. Trotz Zusicherung freien
Geleits zum Konzil von Konstanz durch
König
Sigismund wird er 1415 als Ketzer verbrannt.
-
Nach der Verbrennung von Johannes
Hus gewannen die 'Hussiten' immer mehr an
Boden. Ihre Forderungen (Freiheit der Predigt,
Laienkelch, Armut der Geistlichen, weltliche Strafen
für Todsünden) wurden von König Sigismund verweigert. Die Verweigerung der Forderungen
und die nach dem Tod von Wenzel IV. im Jahr 1419
verstärkten Bemühungen Sigismunds um die Erhaltung
der luxemburgischen Hausmacht in Böhmen führten zu
den 'Hussitenkriegen' (1419 - 1436). Die
Hussiten verfolgten sowohl kirchenreformerische als
auch national-tschechische Ziele.
-
In fünf Kreuzzügen
rannten die katholischen Truppen
- als Vertreter von Kirche und Staat - gegen
die Hussiten an, allerdings
ohne Erfolg. Im Gegenzug dehnten die
Hussiten ihre Kriegszüge bis über die
Reichsgrenzen aus und stellten eine
beständige Bedrohung der Katholiken dar.
Dabei waren die "Hussiten" kein homogener
Gegner, sondern umfassten verschiedene
Strömungen, von denen die militanten
Taboriten und Orebiten
den radikalen Flügel darstellten. Die
Utraquisten galten als
gemäßigt.
-
Nach vielen militärischen
Niederlagen gegen die Hussiten sah sich Sigismund
gezwungen, Verhandlungen mit seinen politischen
Gegnern in Böhmen aufzunehmen. In Basel
gelang 1433 eine Annäherung an die
gemäßigten Utraquisten, die
sich mit kaiserlichen Truppen gegen die
Taboriten verbündeten und
sie im Jahr 1434 bei Lipany
in der heutigen Slowakei vernichtend
schlugen.
-
Am 14.
Juli 1436 erkannten die Hussiten auf dem
Landtag von Iglau Kaiser
Sigismund als rechtmäßigen König von
Böhmen an. Zuvor hatten sie in den
"Prager Kampaktaten"
zugestimmt, die ihnen unter anderem das
Abendmahl in beiderlei Gestalt, also auch
den Laienkelch, erlaubten.
-
Die Hussitenkriege fanden
1436 zwar ein Ende, doch im Innern Böhmens
setzte sich fort, was zum Aufstand der
Hussiten beigetragen hatte und wofür viele
Menschen gestorben waren: sowohl die
Eigenmacht des Adels gegenüber dem König
als auch die Gegensätze und
Eifersüchteleien innerhalb des Adels.
Die Schwäche der staatlichen Ordnung
bestimmte weiterhin das Schicksal Böhmens.
Im Jahr 1462 erklärte Papst Pius II.
die Zugeständnisse an die Hussiten für
ungültig. Nicht zuletzt deshalb verstummten
die Rufe nach Reform nicht mehr.
|
|
|
- Sigismund I.
stirbt am 9. Dezember 1437 in Znaim. Mit seinem Tod endet die
Herrschaft des luxemburgischen Königshauses.
| |
Mit dem Tod Sigismunds war die
männliche Linie des Hauses Luxemburg erloschen. Sein
Stammland, das Herzogtum Luxemburg
hatte Sigismund 1411 an seine Nichte Elisabeth
von Görlitz verpfändet. In Finanznot verkaufte
diese das Herzogtum 1441 an Herzog Philipp den
Guten von Burgund. Bis zum Tod Karls
des Kühnen 1477 blieb Luxemburg unter
burgundischer Herrschaft.
|
|
|
|
Das Königtum im ausgehenden Mittelalter
König Sigismund
König Maximilian I.
Literaturhinweise
Württemberg 1400 - 1520
Köngen 1400 - 1520 (exemplarisch für ein Dorf)
Zurück zum Seitenanfang
|
|
|
Friedrich III. von Habsburg (Deutscher
König 1440 - 1493, römisch-deutscher Kaiser seit 1452)
|
|
-
Die Wahl Friedrichs III. zum deutschen König
| |
-
Nachfolger Sigismunds I., des
letzten Luxemburgers, wird 1438 sein Schwiegersohn,
Herzog Albrecht von Österreich, zum deutschen
König gewählt. Mit ihm beginnt das "ewige
habsburgische Königtum".
Albrecht II. stirbt
bereits 1439.
-
Friedrich
von Innerösterreich
wird zum Vormund des (noch ungeborenen) Sohnes
Albrechts II.. Für diesen Erben (Ladislaus
Posthumus) übernimmt er als
Friedrich III.
1440 die Regierung. Erst zwei Jahre nach der Wahl
bricht Friedrich III. zur Krönungsreise nach Aachen
auf.
|
|
- Persönlichkeit und Regierungsstil
| |
-
Gängige Urteile von Historikern
über die Persönlichkeit Friedrichs III. sind:
"Bedächtiger und zäher Charakter", "von Natur aus
schwerfällig und ohne Tatkraft", "Erzschlafmütze des
Heiligen Römischen Reiches", "nicht energisch genug,
um sich durchzusetzen", "zögernd, schlaff und quallig", "entschlusslos", "phlegmatisch".
| |
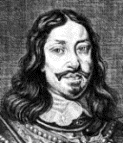 |
Friedrich III. von Habsburg
(* 1415, † 1493), deutscher König von 1440 bis
1493, römischer Kaiser von 1452 bis 1493. |
|
| |
-
Neuere Forschungen zeigen, dass
Friedrich III. durchaus das Pro und Kontra einer
Lage abwog und vor allem
langfristige Ziele
anvisierte. Von aktuellen, vorübergehenden Krisen
ließ er sich nicht über Gebühr erregen.
Paradoxerweise beruhte der Entschluss, in einer
bestimmten Lage nicht zu handeln, auch auf einem
Entschluss. Sein zögerndes Handeln war häufig
Grundlage für große politische Erfolge.
-
Hinter der Politik Friedrichs
III. stand die Vorstellung seiner
königlichen
(und kaiserlichen) Würde und Herrschaftsrechte.
Als Kaiser sah er sich als obersten Gerichtsherr.
Gleichzeitig glaubte er an die imperiale
Sonderstellung des Hauses Österreich.
-
Basierend auf seiner Vorstellung,
oberster Herr des Rechts
zu sein, versuchte
er häufig, politische Konflikte mit Hilfe
juristischer Verfahren zu lösen. Sein juristisches
Herrschaftswissen kam ihm dabei zugute.
-
In seiner Rolle als oberster
Gerichtsherr konnte Friedrich III.
belohnen
und bestrafen: So war es ihm möglich, zur
Belohnung Reichslehen oder Regalien zu vergeben und
als Strafe auch zu entziehen. Zum gleichen Zweck
vergab oder entzog er dem Adel die
"Blutgerichtsbarkeit" (d.h. das Recht, Strafen
an Leib und Leben zu verhängen und zu vollstrecken).
-
Neben den auf dem römischen Recht
basierenden Maßnahmen benutzt Friedrich III. auch
finanzpolitische Instrumente um seine Herrschaft
zu sichern bzw. zu erweitern. In den letzten zwei
Jahrzehnten spielen auch kriegerische Aktivitäten
eine Rolle.
|
|
| |
-
Durch den frühen Tod
Albrechts
II. (deutscher König 1438/39, König von Böhmen
und Ungarn 1437 - 1439) wurden Ansätze einer starken
Reichspolitik auf territorialer Grundlage
(Vereinigung von Österreich, Ungarn und Böhmen)
zerstört.
-
Das 'Landfriedensgesetz'
von 1442, das auf einer Vereinbarung zwischen
Friedrich III. und den Reichständen beruhte, wurde
in der Praxis nicht umgesetzt. Die Fürsten
verfolgten weiterhin ihre Sonderinteressen; dem
König fehlten zur Durchsetzung seiner Ziele
finanzielle und militärische Ressourcen.
-
In dem
Zeitraum 1444 bis 1471
hielt sich Friedrich III. nur in seinen Erbländern
im äußersten Südosten des Reiches auf. Grund waren
Spannungen innerhalb der Familie Habsburg sowie
Auseinandersetzungen mit dem Adel Böhmens und
Ungarns.
| |
An der Spitze einer Allianz
aus ungarischen, polnischen und walachischen
Truppen zog der ungarische
Reichsverweser Johann Hunyadi 1448 den
Türken entgegen. Am 17. Oktober
begann die dreitägige Schlacht auf dem
Amselfeld im Kosovo, genau dort, wo
1389 serbisch-bosnische Truppen 1389 eine
einschneidende Niederlage gegen die Türken
erlitten. Die Geschichte wiederholte sich:
Hunyadi war den Gegnern hoffnungslos unterlegen
und wurde in die Flucht getrieben. Beide
Niederlagen auf dem Amselfeld verankerten sich
tief im serbischen Gedächtnis.
|
|
| |
Siehe Historischer Atlas: Heiliges Römisches Reich um
1450
|
| |
|
| |
- Nach der
Eroberung
Konstantinopels durch die Türken 1453 wartete
man im Reich vergeblich auf ein Engagement des
Kaisers. Eine von den Wittelsbachern angeführte
Fürstengruppe plante die Absetzung Friedrichs III.
| |
Ein Zeitgenosse
Friedrichs schreibt: "Der Kaiser sitzt daheim,
bepflanzt seinen Garten und fängt kleine Vögel,
der Elende". (Friedrich III. hat sich mit
Vergnügen der Agrikultur und der Birnenzucht
gewidmet.) |
| |
|
|
| |
-
Maßnahmen zur
Stärkung der
Zentralgewalt lassen sich seit den sechziger
Jahren deutlich erkennen; nach 1470 beschleunigt
sich die Modernisierung des Reiches.
-
1467
trifft Friedrich III. eine
Maßnahme zur
Friedenssicherung im Reich: Eigenmächtiges
militärisches Vorgehen des Adels (Landfriedensbruch)
wird zum Majestätsverbrechen erklärt, auf das
nach dem Vorbild des römischen Rechts die
Todesstrafe stand. Von dieser Regelung wird mehrmals
Gebrauch gemacht.
-
Maßnahmen zur
finanziellen
Konsolidierung der Königsherrschaft: Sämtliche
königlichen und kaiserlichen Dienstleistungen (z.B.
die Vergabe von Hoheitsrechten) mussten bezahlt
werden. Auf das von Karl IV. verwendete Mittel der
Verpfändung von Reichsgut wird verzichtet.
-
Ab 1471 wird Friedrich III. auch in
den westlichen Grenzregionen des Reichs aktiv.
|
|
- Wahrung und Erweiterung der Hausmacht
| |
- 1444:
Erfolgloser Versuch Friedrichs III., den Schweizern
ihre durch die Schlacht bei Sempach (1386)
gewonnenen habsburgischen Gebiete wieder zu
entreißen.
| |
Ohne Wissen der
Kur- und Reichsfürsten hatte Friedrich III. den
französischen König Karl VII. gebeten, ihn gegen
die Schweizer militärisch zu unterstützen. Die
Söldnerhaufen (Armagnacs), die Karl VII. in das
Reichsgebiet schickte, erlitten in einer
Schlacht in der Nähe von Basel so hohe Verluste,
dass sie aus dem Schweizer Gebiet abzogen und
stattdessen das obere Elsass verwüsteten. Nach
Zwistigkeiten mit dem deutschen Reichstag in
Nürnberg zog sich Friedrich III. aus der
"Schweizer Affäre" zurück, er nahm Rücksicht auf
seine Seelenruhe.
|
| |
|
|
| |
- Spannungen mit den Adligen
Böhmens und Ungarns.
Friedrich III. wahrt die Interessen seiner
Hausmacht.
| |
-
1458 wählte der
ungarische Adel Matthias Corvinus zum
König. Kaiser Friedrich wurde ein Jahr
darauf zum Gegenkönig ernannt. 1463 gelang
ein Arrangement, wonach Friedrich die
Stellung von Corvinus akzeptierte und selbst
als ungarischer König anerkannt wurde.
Bedingung des Kaisers war, dass ihm ganz
Ungarn zustehe, falls Corvinus keine Erben
hat.
-
Corvinus eroberte
Niederösterreich, Kärnten und die
Steiermark. 1485 vertrieb er den Kaiser aus
Wien. 1490 starb er ohne Nachfolger.
|
|
| |
- Spannungen innerhalb der
Habsburgischen Familie
| |
-
Im Verlauf des Krieges
mit seinem Bruder, Herzog Albrecht VI. kommt
es 1462 zu einer demütigenden Belagerung
Friedrichs III. und seiner Familie in der
Wiener Hofburg.
-
1486
setzte Friedrich III. die Nachfolge seines
Sohnes Maximilian als deutschem König
durch. Von diesem Zeitpunkt an regierten
Vater und Sohn gemeinsam.
|
|
|
| |
- Mit dem
Konkordat, das
Friedrich III. 1445 mit dem Papst
abschließt, gewinnt er erhebliche Kontrollrechte für
die Kirche Österreichs, ebenso die Garantie der
Kaiserkrönung.
| |
Ratgeber
Friedrichs III. in dieser Angelegenheit war Enea
Silvio Piccolomini (der spätere Papst Pius II.).
Dieser hatte sich nach seiner Priesterweihe 1445
vom Gegner zum Anhänger der Kurie gewandelt.
Friedrich III. machte diese Umkehr mit, ließ
sich dies jedoch reichlich honorieren.
|
|
| |
- Durch das
Konkordat vom
Februar 1448 wird die weltliche Macht im
Kirchenbereich weiter gestärkt. Friedrich III.
erzielte - neben finanziellen Gewinnen - ein
Mitspracherecht bei der kirchlichen
Stellenbesetzung.
|
|
-
Friedrich III. machte
dieses Konkordat nicht zum Reichsgesetz, so
dass die Regionalfürsten nicht gezwungen
waren, den Vertrag zu akzeptieren. Durch
eigene Verhandlungen mit dem Papst konnten
sie zusätzliche Vorteile herausholen.
-
Durch die Verbindung mit
der weltlichen Macht hat das Papsttum die
geplanten Reformen "an Haupt und Gliedern"
für das 15. Jahrhundert aufgegeben. Das
Papsttum der Renaissance beginnt sich
auszuformen.
|
|
| |
- Friedrich III.
starb 1493 in Linz nach einer spektakulären
Beinamputation. Sein Leichnam, mit kostbaren Wässern
und Salben einbalsamiert, wurde, auf einem Sessel
sitzend, in der großen Stube des Linzer
Schlosses einen Tag lang jedermann gezeigt, dann
nach Wien überführt und, mit dem amputierten Bein
vereint, zu St. Stephan beigesetzt. (Der Sitz ist
symbolhafter Ausdruck der Herrschergewalt.)
|
|
| |
Nebenbei bemerkt: In die Regierungszeit Friedrichs
III. fällt die Erfindung des Buchdrucks mit
beweglichen Lettern aus Metall durch
Johannes
Gutenberg (eigentlicher Name: Johannes Gensfleisch
zur Lade). Auf dem Reichstag in Frankfurt werden im
Herbst 1454 gedruckte, aber noch ungebundene Bibeln
angeboten. Viele Entwicklungen wären ohne diese
Erfindung anders verlaufen oder hätten gar nicht
stattgefunden: Ausbreitung der
Renaissance und
des Protestantismus, industrielle und politische
Revolutionen
der Neuzeit.
|
| |
|
|
|
|
Das Königtum im ausgehenden Mittelalter
König Sigismund
König Friedrich III.
Literaturhinweise
|
|
|
Maximilian I. (Deutscher König 1486 -
1519, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches ab 1508)
|
|
- Die Situation des deutschen Reiches am Ende des 15.
Jahrhunderts
| |
|
| |
| |
- Regelmäßige Einkünfte
sollten den Kaiser in die Lage versetzen,
mit einem zeitgemäß ausgerüsteten Heer den
Frieden nach innen und außen zu
wahren.
| |
Voraussetzung war die Bewilligung von
Reichssteuern
durch die Reichsstände
sowie die Möglichkeit des Herrschers,
diese Steuern durch eigene Behörden
einzutreiben (straffe
Zentralverwaltung). |
| |
|
|
| |
- Erhöhung der
Regierungseffizienz durch Ablösung des
auf die Person des Herrschers ausgerichteten
Hofsystems. Unterstützung des
Herrschers durch ein kollegiales
'Regierungsregiment', das auch in dessen
Abwesenheit aktiv werden konnte.
- Ablösung der regional und
zeitlich begrenzten Friedensordnungen durch
einen 'Ewigen Reichslandfrieden'.
Errichtung von Institutionen zur
Durchsetzung dieses Friedens.
|
|
|
- Das Regierungsprogramm Maximilians
| |
-
Einführung von Reichssteuern
-
Bewahrung des Landfriedens
-
Einführung eines
'Regierungsregiments'
-
Aufstellung eines Reichsheeres
|
| |
| |

|
Maximilian I.
von Habsburg (* 1459, † 1519), 1486 Krönung
zum römischen König, 1493 Übernahme der
Regentschaft über das Heilige Römische Reich,
1508 Ausrufung als erwählter römischer Kaiser
(ohne päpstliche Krönung) |
|
| |
|
|
|
|
|
- Die Einführung von Reichssteuern
| |
-
Die Einführung von Reichssteuern
sollten Maximilian die notwendige Handlungsfreiheit
gewährleisten. Um finanzielle Hilfen der
Reichsstände für einen beabsichtigten Romzug zu
erhalten, beruft Maximilian I. den Reichstag
nach Worms ein.
-
Die Reichsstände befürchteten
durch die Einführung von Reichssteuern eine
Stärkung der Königsmacht.
Berthold von Henneberg, als
Erzbischof von Mainz zugleich Erzkanzler des Reichs,
versuchte, durch Bewilligungsversprechen
Reformmaßnahmen zu erreichen, die auf die
Einschränkung königlicher Macht zugunsten der Stände
zielen und zugleich die Einheit des Reiches stärken
sollten.
-
Der
Wormser Reichstag 1495
stimmte der Einführung von Reichssteuern zu. In der
Folge kamen jedoch nur sehr wenige Reichsstände
ihrer Pflicht nach, die bewilligten Steuern
einzuziehen und an den König abzuführen.
|
| |
| |
-
Keine
Bedrohung von
außen - die
Gefährdung des Reichslehens Mailand durch
die Franzosen, die Türkengefahr im Osten,
die Hilferufe des Deutschen Ordens gegen den
König von Polen - konnte die Reichsstände
dazu veranlassen, dem König die in Worms
bewilligten Steuern zuzuführen.
-
Zur Finanzierung seiner Vorhaben war
Maximilian gezwungen, die
Ressourcen
seiner Erbländer
zu mobilisieren. Dazu gehörten auch die
Silberbergwerke in Tirol.
|
|
|
- Die Bewahrung des Landfriedens
| |
- Damit der von
Maximilian I. in Worms verkündete
"Ewige Landfrieden" auch
Wirklichkeit werden konnte, verabschiedeten die auf
dem Reichstag von Worms zusammengekommenen
Territorialherren, die Reichsstände, gemeinsam mit
dem Kaiser einen Kompromiss zur Reform der
Reichsverfassung. Damit jeder seine
Ansprüche zukünftig nicht mehr durch das überkommene
mittelalterliche Fehderecht, sondern auf einem
geordneten Rechtsweg durchsetzen
konnte, sah der Beschluss die Einrichtung eines vom
Kaiser unabhängigen Reichskammergerichts
vor.
|
| |
- Um die
Reichsstände zur Steuerbewilligung zu bewegen,
akzeptierte er ständische Positionen wie die
Besetzung des Reichskammergerichts und dessen
Lokalisierung außerhalb des Königshofes. Die Kompetenz des
Reichskammergerichts in Angelegenheiten des
Landesfriedensbruchs konnten vom König im Reichstag
durchgesetzt werden.
| |
-
Maximilian I. führte den
Beschluss über das Reichskammergericht loyal
durch: Noch im Jahr 1495 wurde es in
Frankfurt feierlich eröffnet.
-
Die Zuständigkeit des
Reichskammergerichts bezog sich in
erster
Instanz auf Zivilprozesse gegen
Reichsunmittelbare und Fälle von
Landfriedensbruch. Als
zweite Instanz
diente das Reichskammergericht bei der
Anfechtung von Urteilen landesherrlicher und
reichsstädtischer Obergerichte in
Zivilsachen. Das Gericht war in hohem Maße
von den Reichsständen beeinflusst, d.h. vom
König unabhängig.
|
|
| |
- Die in Worms 1495 gefassten
Beschlüsse zum 'Ewigen Reichslandfrieden'
wurden keineswegs schlagartig umgesetzt. So kämpften
einige Reichsstände weiterhin um das Fehderecht.
|
|
- Einführung eines
'Regierungsregiments'
| |
- Die Reichstände verlangten auf
dem Wormser Reichstag 1495 ein von ihnen dominiertes
Reichsregiment. Hier kam es zu keiner Einigung mit
dem König.
| |
Mit einem
ständischen Reichsregiment
wäre dem König
jegliche Entscheidung in Reichsangelegenheiten -
sogar über die Außenpolitik und die
Kriegsführung - genommen worden. |
- Um weiteren
Plänen der Reichsstände für ein ständisch
dominiertes Reichsregiment zuvorzukommen, errichtete
Maximilian in Innsbruck ein
Regiment für die Erbländer
und das Reich, zu dem auch eine Schatzkammer für die
Finanzverwaltung und die Steuereintreibung gehörte.
| |
Hintergrund auch dieser
Maßnahme war, sich Geldmittel zu verschaffen.
Nur mit Hilfe der Geldmittel, die diese Behörden
mobilisierten, konnte sich Maximilian behaupten.
Allerdings konnte die Finanzverwaltung nur in
den Erbländern tätig werden. |
- Als die
Geldquellen aus den Erbländern versiegten, gab
Maximilian auf dem
Augsburger Reichstag
des Jahres 1500 dem Drängen der Reichsstände nach,
ein ständisches Reichsregiment zu akzeptieren, in
der Hoffnung, der Reichstag würde neue Reichssteuern
bewilligen.
| |
Auch dem in Nürnberg
residierenden Regiment gelang es nicht, die
Stände zur Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber
dem Reich zu bewegen. Die ständisch dominierte
Reichsverfassung blieb so ein kurzfristiges
Intermezzo. Das Reich kehrte zu einer
gemischt monarchisch-ständischen Verfassung
zurück. Bezüglich der Reichssteuern blieb der
König Bittsteller. Er hatte weiterhin keinen
Einfluss auf die Eintreibung von Steuern.
|
|
- Aufstellung eines Reichsheeres
| |
- Der Wormser
Reichstag hatte die
Aufstellung
eines Reichsheeres
beschlossen.
|
| |
- Trotz des
Mangels an finanziellen Ressourcen ist es Maximilian
im Laufe seiner Regierungszeit gelungen, den
Landsknechten eine
straffe, einheitliche
Organisation
zu geben.
|
| |
- Trotz seiner
persönlichen Vorliebe für die Reiterei und das
Geschützwesen, legte Maximilian den Schwerpunkt
seines Militärs auf das
infanteristische Söldnerwesen.
| |
- Das
Fußvolk kämpfte nun erfolgreich in
geschlossenen, quadratischen
'Gevierthaufen'. Auch die Berittenen traten
nicht mehr als Einzelkämpfer, sondern als
Formation auf. Die Geschütze wurden zur
Begleitwaffe der infanteristischen
Söldnerheere.
|
| |
- Die
Bereitschaft des Söldnerheeres, für die
Interessen des Königs zu kämpfen, hing vor
allem von der Höhe des Soldes ab. Solange
sie nicht bezahlt wurden - und dies kam
häufig vor - waren sie kampfunwillig. Ganze
Kompanien wurden aus Geldgründen zur
Fahnenflucht veranlasst.
|
|
|
- Die Heiratspolitik Maximilians
| |
- 1477: Heirat Maximilians
mit der reichsten Erbin seiner Zeit,
Maria von
Burgund, der Tochter des kurz zuvor gefallenen
Karls des Kühnen. Eingefädelt wurde diese Hochzeit
von seinem Vater (Friedrich III.)
| |
- Mit dieser Hochzeit wurde
die Basis für das weitere Ausgreifen des
Hauses Habsburg - auch nach dem Tod Marias
im Jahre 1482 - geschaffen. Es bedurfte
allerdings eines
15jährigen Krieges,
ehe es gelang, bedeutende Teile des
burgundischen Erbes an das Haus Habsburg zu
binden.
- Mit der burgundischen
Heirat Maximilians beginnt eine Serie von
genealogischen Zufällen aus Heiraten,
Todesfällen und Erbschaften, die den
Habsburgern innerhalb von wenigen
Jahrzehnten zu einem Reich verhalf, in dem
"die Sonne nicht unterging".
|
|
| |
-
1495:
Doppelhochzeit der beiden Kinder aus Maximilians
burgundischer Ehe, Philipp dem Schönen und
Margarethe, mit den Kindern des spanischen
Königs (Ferdinand II. von Aragón),
Johanna
und Johann.
-
Der Infant
Johann stirbt
ein halbes Jahr nach der Eheschließung. Nach dem Tod
ihrer beiden älteren Geschwister
Johann
und
Isabella
wird
Johanna die Erbin der
spanischen Königreiche. Nach dem Tod ihrer
Mutter
Isabella I. von Kastilien und León im Jahr 1504
reklamiert Johanna das Königreich Kastilien für
sich. Mit Philipp hatte Johanna zwei Söhne und eine
Tochter. 1506 erliegt ihr Mann,
Philipp der
Schöne, erst 28 Jahre alt, einem Fieberleiden.
Nach dem Tod ihres Mannes verfällt Johanna in eine
tiefe Depression. Zunächst führt
Ferdinand II.
für sie die Regentschaft in Kastilien, dann, ab
1516, ihr Sohn Karl, der spätere Kaiser des Heiligen
Römischen Reiches, Karl V.
(reg. 1530-1536).
Bis zu ihrem Tod am 12. April 1555 in Tordesillas
bleibt Johanna formal Königin. Der jüngere Sohn wird
1556 zum Kaiser Ferdinand I. (reg. 1556-1564)
gekrönt.
|
| |
| |
Nach dem Tod der
Ehefrau Ferdinands II. von Aragón,
Isabella
von Kastilien und León
(der Katholischen),
im Jahre 1504, hätte ein weiteres Kind aus der
zweiten Ehe des spanischen Königs mit der
französischen Prinzessin
Germaine de Fois
die Herrschaft der Habsburger noch verhindern
können. Die Ehe blieb jedoch kinderlos.
|
|
| |
-
Das Fundament der Herrschaft über
die Königreiche Ungarn und Böhmen wird
1515
in der "Wiener Doppelhochzeit" gelegt.
Maximilian heiratet, stellvertretend für einen
seiner Enkel Karl und Ferdinand, Anna, die Tochter
König Wladislaws von Polen. (Er hatte sich zu
diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden, welcher
Enkel Anna heiraten sollte). Maximilians Enkelin
Maria heiratete Wladislaws einzigen Sohn,
Ludwig.
(Maria war zehn Jahre alt, Ludwig neun.)
-
1516
wird Anna von Böhmen und Ungarn, mit dem jüngeren
der beiden Kaiserenkel, Ferdinand, getraut.
-
1526
stirbt der Sohn Königs Wladislaws von Polen in der
Schlacht bei Mohács. Durch die
Kinderlosigkeit seiner Ehe mit Maximilians Enkelin
Maria wird die habsburgische Erbfolge ermöglicht.
|
|
-
Durchsetzung und Sicherung der Erbschaften
| |
- Der Erbfolgekrieg um Burgund
| |
-
Am 7. August 1479 gelingt
Maximilian bei Guinegate (Théouranne)
ein Sieg gegen den französischen König
Ludwig XI. (1461-1481).
-
Maximilian muss sich
gegen die niederländischen Städte
durchsetzen, die danach strebten, den ihnen
aufgezwungenen Einheitsstaat wieder
aufzulösen und ihre provinziellen
Selbständigkeiten zurück zu gewinnen.
-
Krieg gegen Frankreich
auch um das zum Reich gehörende Herzogtum
Mailand.
-
1482:
Im Frieden von Arras muss Maximilian
seine Tochter Margarethe dem künftigen Karl
VIII. von Frankreich versprechen (Im
gleichen Jahr war Maria von Burgund bei
einem Jagdunfall gestorben).
-
1493 Friede von Senlis:
Das Herzogtum Burgund wird zwischen der
französischen Krone (Karl VIII.) und
Habsburg (Maximilian) geteilt.
|
|
| |
- Der Kampf um Böhmen und Ungarn
| |
- 1490:
Beendigung der Erbteilungen innerhalb des
Hauses Habsburg. Vereinigung aller
habsburgischen Herrschaftslinien bei
Friedrich III. und seinem Sohn Maximilian.
| |
Nachdem
1457 die niederösterreichische Linie
ausgestorben war, blieb auch die Tiroler
Linie ohne Erbe: Sigmund, Erzherzog von
Österreich-Tirol, hatte keine legitimen
Erben, so dass er sich 1490 entschloss,
seine Länder an König Maximilian zu
übergeben. Maximilian gelangte so in den
Besitz der reichsten Silberbergwerke
Europas.
|
|
| |
|
|
Mit
Nachdruck hatte Matthias seinen Anspruch
auf die Krone in Ungarn gegen den
Habsburger Kaiser Friedrich III.
durchgesetzt. Als der böhmische König
von Podriebrad eine Revolte des
österreichischen Adels gegen Friedrich
III. unterstützte, trat Matthias auf die
Seite des Kaisers. Er eroberte Mähren
und Schlesien und ließ sich 1469 als
Gegenkönig Georgs in Böhmen wählen.
|
|
|
|
|
|
| |
- Der Krieg mit den Schweizern
| |
- Die Schweizer weigerten
sich, die Beschlüsse des Wormser Reichstags
von 1495 (Reichssteuer, Zuständigkeit des
Reichskammergerichts) anzunehmen. Sie sahen
in der neuen Reichsverfassung eine
Bedrohung ihrer Selbständigkeit.
|
| |
- Bei dem 1499 beginnenden
Krieg ging es Maximilian - neben der
Verpflichtung der Schweizer zur Reichstreue,
d.h. vor allem zur Abgabe von Reichssteuern
- um die Reaktivierung und Ausdehnung
seiner Herrschaftsrechte in Tirol.
|
Für
Maximilian waren der Ausbau seiner
Positionen in Tirol und die Sicherung
des Engadins von großer Bedeutung, ging
es doch um die Verbindung zum Herzogtum
Mailand, das aufgrund seiner Heirat mit
der Nichte des Herzogs 1493 in das
Zentrum der königlichen Politik rückte. |
|
| |
-
In mehreren Schlachten in
Graubünden und Tirol siegten die
Eidgenossen. Auch im Bodenseegebiet waren
sie erfolgreich: in der
Schlacht an der
Calven gegenüber einem tirolischen
Aufgebot, in der
Schlacht bei Dornach
(22.7.1499) gegenüber den Kontingenten des
Schwäbischen Bundes.
-
Am 22.September 1499 wird
in Basel ein Friedensvertrag unterzeichnet,
in dem sich die Schweizer den
Erwerb
einst habsburgischer Territorien
bestätigen ließen. Außerdem wird die
Eidgenossenschaft von der Reichssteuer
freigestellt und das Reichskammergericht für
die Schweiz nicht zuständig erklärt. Die
Reichszugehörigkeit blieb jedoch
unbestritten.
|
|
| |
| |
- Nach dem
Basler
Frieden von 1499 hatten sowohl
Maximilian als auch die Schweiz freie Hand,
in den Kampf um die Herrschaft in Italien
einzutreten.
| |
Angestoßen wurde der Konflikt um Italien
vom französischen König
Karl VIII.
.Er hatte 1494 versucht, das Königreich
Neapel-Sizilien zu erobern, um die vom
Haus Anjou beanspruchten Rechte
durchzusetzen. Obwohl Karl VIII.
scheiterte, setzte sein Nachfolger,
Ludwig XII., die französische
Italienpolitik fort. Ludwig XII.
konzentrierte sich auf den Erwerb des
Herzogtums Mailand.
|
|
| |
-
Maximilian sah in dem
Besitz Italiens einen wichtigen Faktor für
die Stellung des römisch-deutschen
Kaisertums und für die Vorherrschaft in
Europa. Bei der Eröffnung des Reichstags in
Worms 1495 forderte er von den Reichsständen
"eilende Hilfe" zur Verteidigung des
Reiches - allerdings vergeblich.
-
1499: Mit Hilfe
von in der Schweiz angeworbenen Söldnern
wurde der Herzog von Mailand,
Ludwig
Sforza, von den Franzosen vertrieben.
Maximilian, der durch die Ehe mit
Bianca
Maria Sforza persönlich mit dem
Herzoghaus verbunden war, konnte es aufgrund
mangelnder Ressourcen nicht verhindern.
-
1509
wird das Bündnis mit Frankreich von den
Schweizern nicht erneuert. Sie verfochten
nun eigene Ziele.
-
Im
Sommer 1512
besetzen die Schweizer Mailand.
Massimiliano, der Sohn des von den Franzosen
gefangenen Herzog Ludwigs, wird als Herzog
eingesetzt - die faktische Herrschaft übten
die Schweizer aus.
-
Der Versuch Maximilians,
die Schweizer an einem
Angriff gegen
Frankreich zu beteiligen (zusammen mit
burgundisch-habsburgischen und englischen
Truppen) scheiterte: Hohe französische
Geldzahlungen brachte die Schweizer Truppen,
die bei der Stadt Dijon kämpfen sollten, von
ihrem Angriff ab.
-
Im Februar 1508 bricht
der große Venezianerkrieg aus, der
acht Jahre dauerte und in den fast alle
europäischen Großmächte verwickelt waren.
Den äußeren Anlass bildete der Wunsch
Maximilians, sich in Rom zum Kaiser krönen
zu lassen. Venedig verwehrte ihm mit
Waffengewalt den Durchzug. Bei der
Belagerung von Padua wird die Armee
Maximilians durch Venedig abgekauft.
|
| |
- In den Jahren von 1508
bis zum Tod Maximilians im Jahre 1519
versuchten Frankreich und die Schweizer
Eidgenossen Eroberungen in Italien zu
machen, während der deutsche Kaiser -
aufgrund der fehlenden Unterstützung durch
die Reichsstände - in diesen
europäischen Machtkampf kaum eingreifen
konnte.
|
Die
Schweizer unterlagen 1515 gegen ein
französisches Heer. Ihre früheren
Erfolge wurden dadurch zunichte gemacht.
Das Herzogtum Mailand kam wieder in den
Besitz Frankreichs. Die Schweizer
Eidgenossen beschlossen, sich in Zukunft
aus kriegerischen Auseinandersetzungen
heraus zu halten. In einer Erklärung vom
14. September 1515 verzichteten sie auf
weitere Angriffskriege. Neutralität
sollte von nun an prägender Bestandteil
der Eidgenossenschaft sein.
|
|
|
| |
Nebenbei bemerkt: In die Regierungszeit Kaiser
Maximilians fällt die Wiederentdeckung Amerikas
durch Christoph Kolumbus
(1492). Seinem Weg
folgen später Eroberer und Missionare, Siedler und
afrikanische Sklaven, Waren und Ideen. Dafür kommen Gold
und Silber nach Europa, Kartoffeln, Tabak, Mais - und
der Traum von einer "Neuen Welt".
|
| |
|
| |
Nebenbei bemerkt: Peter Henlein,
deutscher Schlosser und Feinmechaniker (*zwischen 1479
und 1485 in Nürnberg, † 1542 in Nürnberg) stellte um
1510 als Erster dosenförmige
Uhren her. Dadurch wurde die Zeitmessung
transportabel gemacht. Bei Uhrmachern und Historikern
sind die Person und das Werk Peter Henleins (auch Hele
oder Henle) nicht unumstritten.
Fest steht, dass Henlein
eine
Technik entwickelt hat, Uhrwerke so klein
und schwerkraftunabhängig zu machen,
dass sie am Körper getragen werden konnten. Der Humanist
und Theologe Johannes Cochlaeus
schreibt im Jahr
1512 folgendes:
„Petrus Hele macht Uhren,
die selbst die gelehrtesten Mathematiker bewundern. Er
fertigt nämlich aus wenig Eisen Werke mit sehr vielen
(Zahn)rädern, die immer wie man sie kehrt und wendet,
ohne jedes Gewicht 40 Stunden lang (die Zeit) zeigen und
schlagen, auch wenn man sie an der Brust oder in der
Gürteltasche trägt.“
Fakt
ist allerdings, dass Peter Henlein weder den
‚Federzugantrieb‘ noch die ‚Unruhe‘
erfand.
|
|
|
|
Allen
Schülern und Studenten, die gerade eine Prüfung zu bestehen
haben, wünschen wir viel Erfolg. Wir drücken auch die
Daumen für diejenigen, die eine Klausur schreiben müssen oder
eine Hausarbeit bzw. Referat anzufertigen haben.
|
|
|
Literaturangaben
|
|
|
Angermeier, Heinz
|
Die Reichsreform 1410 -
1555. Die Staatsproblematik in Deutschland zwischen
Mittelalter und Gegenwart. München 1989.
|
|
Hoensch, Jörg K.
|
Die Luxemburger: Eine
spätmittelalterliche Dynastie.
|
|
Hoensch, Jörg K.
|
Kaiser Sigismund.
Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit 1368 - 1437 (1996)
|
|
Körber, Esther
|
Habsburgs europäische
Herrschaft. Von Karl V. bis zum Ende des 16.
Jahrhunderts. Geschichte Kompakt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft 2002. 160 Seiten
|
|
Krieger,
Karl-Friedrich
|
Die Habsburger im
Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich III. 1994
|
|
Leuschner, Joachim -
Boockmann, Hartmut
|
Europa im Hoch- und
Spätmittelalter.1982.
|
|
Lutz, Heinrich
|
Das Ringen um deutsche
Einheit und kirchliche Erneuerung. Von Maximilian I. bis
zum Westfälischen Frieden. 1490 bis 1648. Propyläen
Geschichte Deutschlands, Band 4. Berlin 1983
|
|
Moraw, Peter
|
Von offener Verfassung zu
gestalteter Verdichtung. Das Reich im späten Mittelalter
1250 - 1490 (Propyläen-Geschichte Deutschlands, Band 3,
1985)
|
|
Schubert, Ernst
|
Einführung in die
deutsche Geschichte im Spätmittelalter (1998)
|
|
Seibt, Ferdinand (Hg.)
|
Handbuch der Europäischen
Geschichte, Band 2, (1994 4. Auflage)
|
|
Thomas, Heinz
|
Deutsche Geschichte des
Spätmittelalters 1250 - 1500, (1983)
|
|
|
| |
Und hier ein
Roman, der neben
einer spannenden Geschichte auch außergewöhnlich gut das
gesellschaftliche Leben des 15. Jahrhunderts
beschreibt: Vandenberg, Philipp:
Der
Spiegelmacher. |
|
|
|
Das Königtum im ausgehenden Mittelalter
König Sigismund
König Friedrich III.
König Maximilian I.
Literaturhinweise
Schwaben 1400 - 1520
Köngen 1400 - 1520 (exemplarisch für ein Dorf)
zurück zum Seitenanfang
|
|
|
Zurück zum
Inhaltsverzeichnis Deutsche Geschichte
weiter zur
nächsten Seite
zurück zur vorangehenden Seite
|
|
|
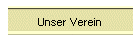  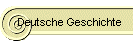 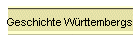 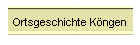 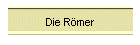 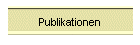 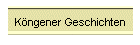 |
|
|
Stand: 20.01.2019
Copyright © 2019 Geschichts- und Kulturverein Köngen e.V.
Autor: Dieter Griesshaber |
|
Datenschutzhinweis
|
|